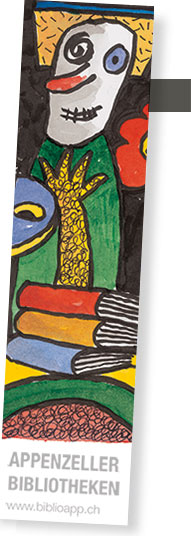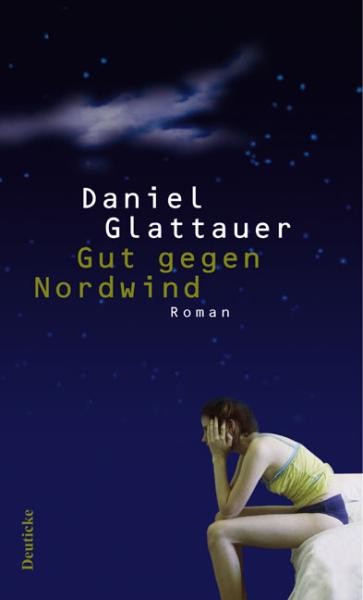Glattauer, Daniel. Gut gegen Nordwind : Roman. - Wien : Deuticke Verlag, 2006.
(ISBN 978-3-552-06041-8)
Ein Buchstabe, ein einziger Buchstabe ist jeweils entscheidend. Am Anfang ist es ein E und am Ende ein I: „Lieber Herr Leike, das ist mir jetzt wirklich überaus peinlich. Ich habe leider einen chronischen „Ei“-Fehler, also eigentlich einen „E“ vor „I“-Fehler. Wenn ich schnell schreibe, und es soll ein „I“ folgen, rutscht mir immer wieder ein „E“ hinein. Es ist so, dass sich da meine beiden Mittelfingerkuppen auf der Tastatur bekriegen. Die linke will immer schneller als die rechte sein. Ich bin nämlich eine gebürtige Linkshänderin, die in der Schule auf rechts umgepolt wurde…“ Mit diesen Worten erklärt Emmi Rothner Leo Leike den Verschreiber in der E-Mail-Adresszeile, der sie, da die falsche Adresse nach erstmaliger Benutzung gespeichert war, fünfmal unfreiwillig in der fremden Mailbox landen liess.
Wiedererkennungsmoment
Es entsteht ein E-Mailwechsel, wie er auf die Schnelle entstehen kann: spontan, witzig, neckisch, ein kleiner schriftlicher Flirt, persönlich, offen, ein Austausch, der zum Schmunzeln verleitet und anschliessend in den Tiefen der Mailbox verschwindet – in der Regel wenigstens. In Daniel Glattauers Roman ist dies nicht der Fall: Der E-Mailwechsel geht weiter. Dem Autor gelingt es, auf 223 Seiten eine Geschichte zu erzählen, die aus ganz wenigem besteht: aus Schuhgrösse 37, aus einem Sprachpsychologen mit einer Schwester, aus Marlene, Mia und aus Bernhard. Die Neugierde am anonymen Gegenüber hält die Spannung aufrecht – das Interesse der beiden aneinander wird von Seite zu Seite gesteigert und findet sich unvermittelt in Sätzen wie: „Leo, ich hab Sie sehr, sehr gern.“ Eine Liebesgeschichte.
E-Mail-Roman
Nicht nur der Stoff, auch das Genre ist altbekannt. Der Briefroman erlebte im 18. Jahrhundert eine Blütezeit (Rousseau, Nouvelle Héloise; Goethe, Werther). Wie im Briefroman weiss der Leser auch im E-Mail-Roman nicht mehr als die erzählenden Personen und erfährt von diesen in abwechselnder Perspektive die Handlung. Im Unterschied zum Briefroman hat der E-Mail-Roman etwas Neues und Faszinierendes: Der Faktor Zeit kann effektvoller eingesetzt werden. Und genau dies macht eine der Stärken des Romans aus: Kurze E-Mails im Abstand von wenigen Sekunden und Minuten geben eine gesprächsähnliche Situation wieder, während eine Nicht-Antwort nach Tagen und dreimaligem Nachfragen zum offensichtlich entrüsteten „Arschloch!“ führen kann. Die Betreffzeile bleibt oft leer; Leos E-Mail-Programm generiert bei einer Antwort automatisch ein AW, während Emmis E-Mail-Programm ein RE erzeugt. Wird die Betreffzeile genutzt, so steht „Offene Fragen“, „Prost“, „Endlich gesendet“ oder „Verrat“.
Kommunikationskunst
„Schreiben Sie mir, Emmi. Schreiben ist wie küssen, nur ohne Lippen. Schreiben ist küssen mit dem Kopf.“ – Treffender und für unsere Zeit symptomatischer könnte es nicht gesagt werden. Im Zeitalter der individuellen Reisen im Netz hat die Schriftlichkeit als Medium des neutralen Ausdrucks ohne soviel von sich preisgeben zu müssen, dass man „ertappt“ wird, eine besondere Bedeutung erlangt. Die Hemmschwelle, sich konkret und sehr persönlich auszudrücken, ist niedrig. Es ist nicht die Stimme, nicht die Mimik und Gestik, nicht die Augenfarbe, die Haarfarbe oder das Outfit, nicht einmal das Alter, das vom Gegenüber wahrgenommen werden kann. Der Austausch bleibt auf die Ebene von Buchstaben, Wörtern und Sätzen beschränkt, und die Person, die dahinter steckt, kann, so sie es will, ihre Anonymität wahren. Sie muss auch nicht sofort reagieren, wie dies in einer realen Gesprächssituation der Fall ist, – und vor allem muss sie kein Augenzwinkern, kein herzerfrischendes Lachen, keinen teilnahmslosen Blick oder keinen Geruch, der vielleicht sehr oder überhaupt nicht behagt, richtig einordnen und in die Kommunikationssituation miteinbeziehen. Es ist also nur das geschriebene Wort, das die Neugierde am jeweils anderen weckt, eine einzige Dimension im Kommunikationsgeflecht, und diese eine Dimension bringt es fertig, Leidenschaft zu entfachen. „Das ist Kommunikationskunst auf höchstem Niveau“, steht auf dem hinteren Umschlagdeckel. Diese Aussage ist in jeder Hinsicht zu unterstreichen.
Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen